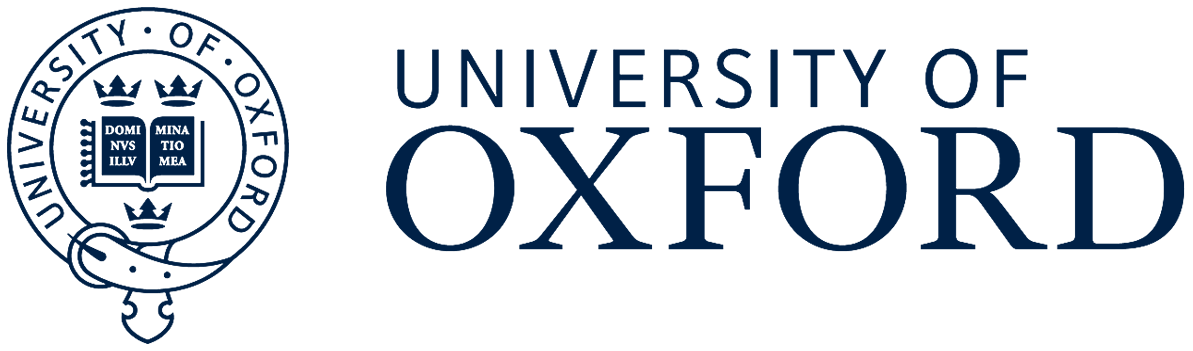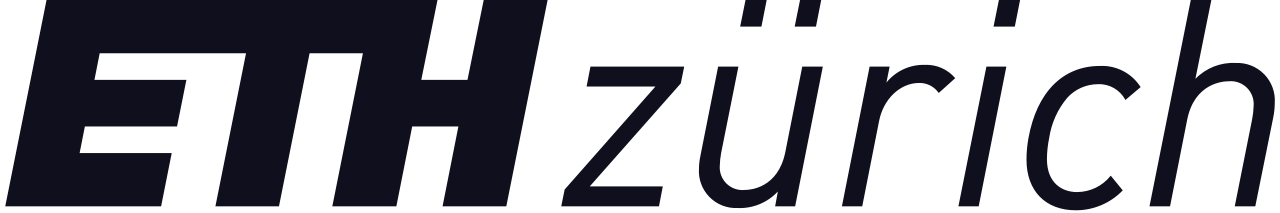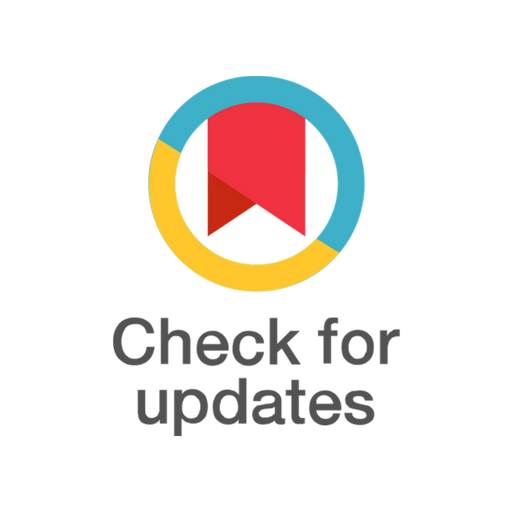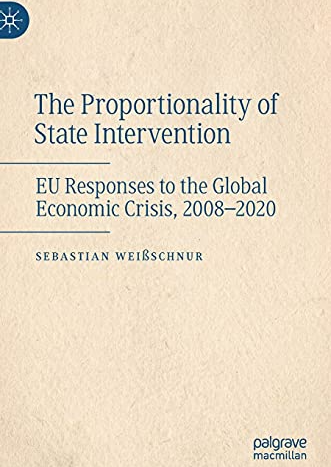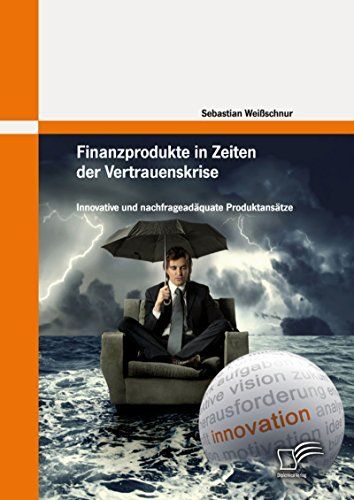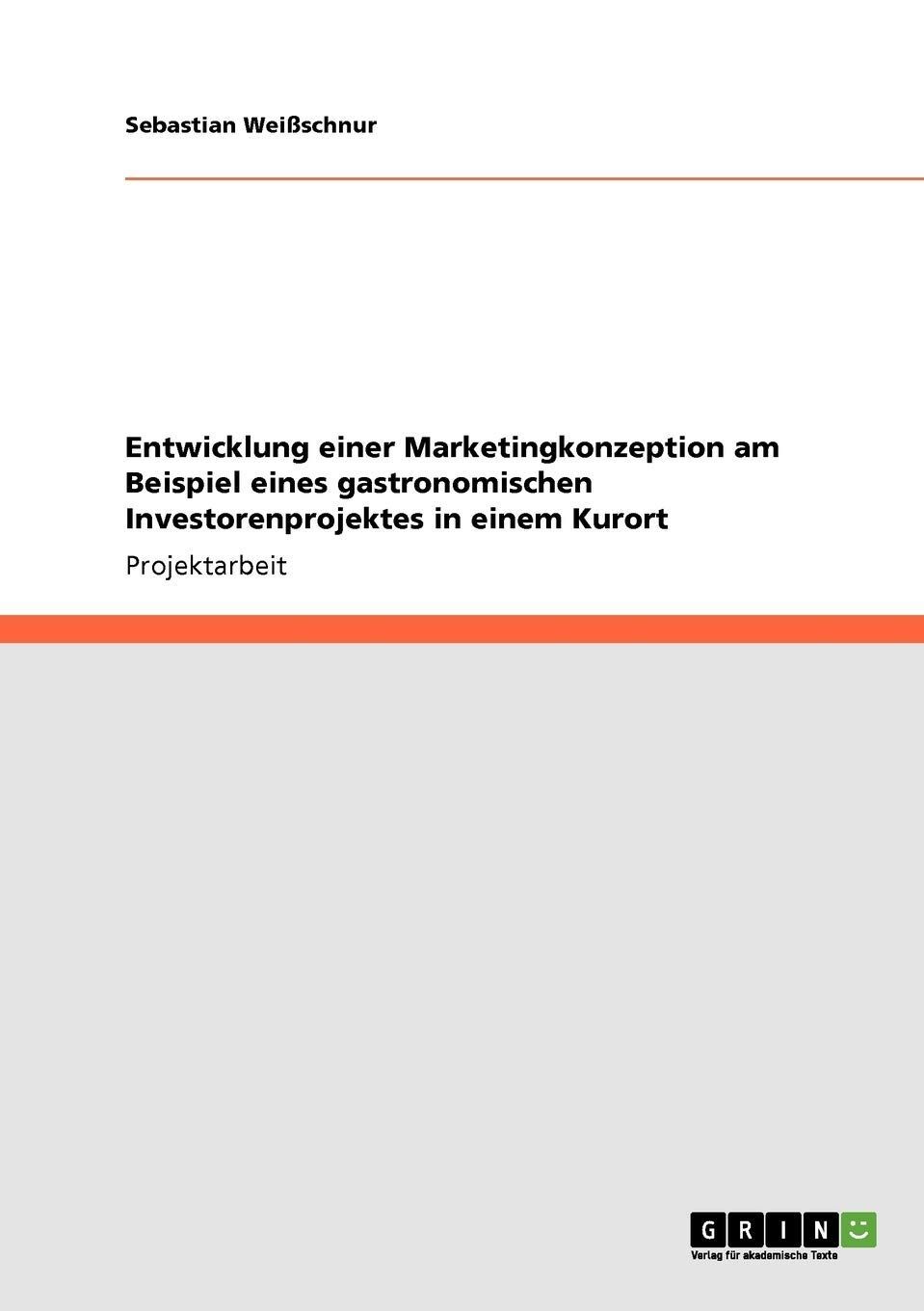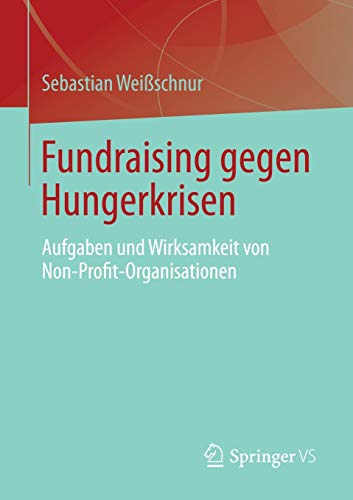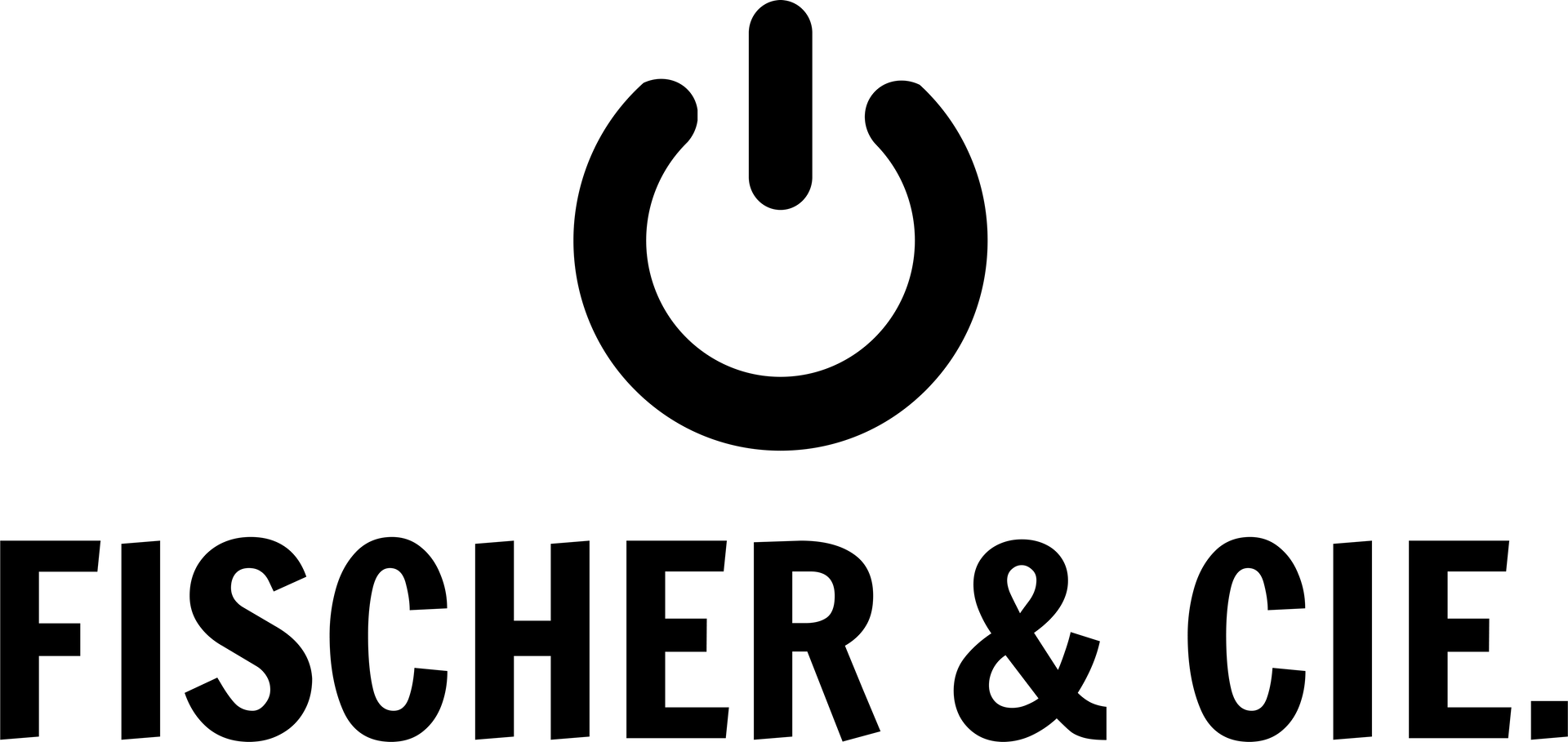Die Verhältnismäßigkeit staatlicher Interventionen
Reaktionen der EU auf die globale Wirtschaftskrise, 2008–2020
ISBN 978-3-030-75675-8
Für Dozenten, politische Berater und Studenten im Thema Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das Buch analysiert Grundsätze der Verhältnismäßigkeit staatlicher Eingriffe und moderne Währungs- und Wirtschaftsstrategien der Europäischen Union. Erforschen Sie Ursachen und Auswirkungen der Entscheidungen zur europäischen Finanzkrise, diverse Optionen für Markteingriffe der EU-Regierungen und mögliche Strategien für Wirtschaftswachstum.
Erhältlich in renommierten Universitäten und Bibliotheken weltweit:
Themenübersicht
-
Staatliches Eingreifen & Verhältnismäßigkeitsprinzip
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Theorien staatlicher Intervention sowie die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität kritisch beurteilt. Neofunktionalismus, Intergouvernementalismus und Postfunktionalismus sind die drei erörterten Theorien staatlicher Intervention, gefolgt von einem Überblick über das Wesen staatlicher Intervention in Planwirtschaften und freien Marktwirtschaften. Die EU wird als liberaler freier Markt beschrieben, der auf den Grundsätzen des Neoliberalismus beruht, in dem Kapitalismus, Demokratie und Liberalismus miteinander kombiniert werden. Der Neoliberalismus wird dann im Hinblick auf die zugrundeliegenden Theorien von Public Choice und Rational Choice untersucht, gefolgt von dem Konzept der Verhältnismäßigkeit, seinen theoretischen Ursprüngen, seiner praktischen Anwendung und seinen Verbindungen zur Gerechtigkeitstheorie. Am Ende dieses Kapitels wird ein Überblick über die Interventionen der EU nach der Finanzkrise 2007-2008 und ihre Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten gegeben.
Theorien der europäischen Integration
- Neofunktionalismus
- Intergouvernementalistische Theorie
Staatliche Intervention durch die EU
- Postfunktionalismus
- Theorien, die dem Aufkommen des
Neoliberalismus zugrunde liegen
- Public-Choice-Theorie
- Rational-Choice-Theorie
Das Konzept und die Definition der Proportionalität, theoretische Wurzeln und praktische Anwendungen
- Gerechtigkeitstheorie
Das Wesen staatlicher Interventionen in den Industrieländern nach der Krise
- Finanzreformen
- Finanzielle Stabilisierung
- Verbesserung der wirtschaftlichen Governance
- Schaffung von Wirtschaftswachstum
- Das Konjunkturprogramm 'Economic Recovery Plan (ERP)'
Überblick über die Auswirkungen der staatlichen Intervention nach 2008
- Wirtschaftliche Auswirkungen
- Soziale Auswirkungen
-
Weltwirtschaft vor und nach der Wirtschaftskrise 2007
Die wichtigsten Ereignisse, die in den Jahrzehnten vor der Krise 2007-2008 stattfanden, werden bewertet, darunter das Aufkommen der Verbriefung, wesentliche Änderungen der Regulierung, die freiere Finanzmärkte und eine hohe Marktliquidität schufen. Die Auswirkungen der Krise, die sich aus diesen Veränderungen ergaben, werden im Hinblick auf ihre schwerwiegenden finanziellen Folgen für den Bankensektor in den USA und in den EU-Ländern, die sozialen Auswirkungen des Vertrauensverlusts der Öffentlichkeit und die neuen EU-Rechtsvorschriften bewertet, die verhindern sollen, dass die Steuerzahler für die Rettung von in Konkurs gegangenen Banken in den Mitgliedstaaten aufkommen müssen. In den letzten beiden Abschnitten dieses Kapitels wird die Schwere der Krise im Allgemeinen und in Bezug auf bestimmte Gruppen von EU-Mitgliedstaaten - Nordeuropa, Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien (PIIGS) sowie Osteuropa - bewertet.
Ereignisse, die zur globalen Rezession 2007 führten
- Ursprünge der Faktoren und Anfangssymptome
- Historische Einflüsse
- Verbriefung
- Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere
- Vorteile von SPVs
- Finanzmärkte unmittelbar vor der Krise 2007
- Veränderte Regulierung
- Liquidität
Folgen der Krise
- Überblick über die finanziellen Auswirkungen
- Wirtschaftliche Auswirkungen
- Wettbewerb im Finanzsektor
Ausmaß der Krise
- Überblick
- Die Krise in Europa
- Verbriefungstendenzen in der EU
- Erste europäische Reaktion
- Die Zeitachse der EU-Krise
Die Krise in verschiedenen europäischen Ländern
- Nordeuropa
- Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien (PIIGS)
- Ost-Europa
-
Interventionen durch Regierungen
Im ersten Teil dieses Kapitels werden die wichtigsten Methoden, mit denen Regierungen in die Märkte eingreifen, aufgezeigt und erörtert: Geld- und Steuerpolitik sowie Interventionen bei Banken. Die Rolle der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität bei der Art und Weise, wie die EU in die Märkte eingreift, wird bewertet, bevor die Einzelheiten ihrer Interventionen unter Anwendung der drei Hauptmethoden untersucht werden. Die Geld- und Finanzpolitik wird im Hinblick auf die 17 Mitgliedstaaten der Eurozone erörtert, die nach der Krise 2007-2008 das Hauptanliegen der EU waren, und die Geldpolitik, die sich auf alle 27 Mitgliedstaaten auswirkt und auf der Koordinierung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit den nationalen Zentralbanken beruht. Die Haushaltsdisziplin wurde in den Ländern der Eurozone als wichtiger erachtet, die eine Reihe von Standardinterventionen einführen mussten, um die von der EU auferlegten Kriterien für den Schuldenstand zu erfüllen.
Optionen für staatliche Interventionen
- Intervention in die Märkte
- Marktversagen
- Eingesetzte Instrumente für staatliche Interventionen
- Fiskalpolitische Intervention
- Geldpolitische Interventionen
- Intervention bei Banken
Staatliche Interventionen in der EU
- EU-Subsidiarität und Proportionalität
EU-Regierungsinterventionen in die Märkte
- Geld- und Fiskalpolitische Maßnahmen
- Festlegung der Geldpolitik
- Fiskalpolitische Intervention
- Intervention bei Banken
- Intervention durch Steuern, Subventionen und Regulierung
- Interventionen auf den Arbeitsmärkten
-
Überblick über die Reaktionen der EU auf die globale Wirtschaftskrise
Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Teile: die wichtigsten Reaktionen der EU auf die Krise 2007-2008 und die unterschiedlichen Auswirkungen, die sie auf die wichtigsten Mitgliedstaaten der Eurozone hatten. Die wichtigsten EU-Reaktionen sind Finanzreformen, finanzielle Stabilisierung, Verbesserung der wirtschaftspolitischen Steuerung, Finanzierung dieser Maßnahmen und Interventionen zur Förderung des Wirtschaftswachstums. Die gleichen Maßnahmen wurden allen Mitgliedern der Eurozone auferlegt, mit unterschiedlichem Erfolg, wie die beiden schweren Krisen in Griechenland und Italien zeigen. Grundlegende Unterschiede zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU in Bezug auf einige politische Maßnahmen werden erörtert, da diese entscheidend dazu beigetragen haben, dass ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft und die Entscheidung der britischen Wähler für den Austritt aus der EU abgehalten wurde.
Überblick über die Reaktion der EU auf die Krise 2007-2008
- Finanzielle Reform
- Finanzielle Stabilisierung
- Verbesserung der wirtschaftspolitischen Steuerung
- Finanzierung der Maßnahmen
- Schaffung von Wirtschaftswachstum
Die großen Krisen der Eurozone 2015 bis 2018: Fallstudien Griechenland, Italien und Großbritannien
- Griechenland
- Griechenland in der Eurozone 2007-2014
- Griechenland-Krise 2015
- Griechenland 2018-2019
Italien
- Die Bedrohung der EU und der Eurozone durch Italien
Das UK: Brexit
-
EU-Initiativen
Das EU-Konjunkturprogramm und die Antriebskräfte für das Wachstum im EU-Binnenmarkt für den Zeitraum ab 2008 sind die wichtigsten Themen, die in diesem Kapitel bewertet werden. Das EU-Konjunkturprogramm wird im Hinblick auf die Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums kritisch bewertet, insbesondere in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen für unter 25-Jährige, die aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit vor allem in den südeuropäischen Mitgliedstaaten erforderlich war. Der Überwachungsplan wird ebenfalls bewertet, einschließlich der Kritik an seiner vermeintlich mangelnden Wirksamkeit durch unabhängige Experten. Der EU-Binnenmarkt wird im Hinblick auf die erklärten Wachstumsmotoren, den Investitionsplan zur Erreichung dieser Ziele und eine spezifische Strategie zur Ermöglichung des Wirtschaftswachstums in Griechenland untersucht, da das Land sein drittes Rettungspaket erhielt, was das Scheitern früherer EU-Interventionen widerspiegelt.
Das Konjunkturprogramm
- Programmdetails
- EU 2020 Wachstumsstrategie
- Der EU-Pakt für Wachstum und Beschäftigung und Jugendinitiativen
- Überwachung des ERP und der 2020-Strategie
- Überprüfung der 2020-Ziele
- Externe Bewertung des ERP
Der EU-Binnenmarkt
- Triebkräfte für Wachstum
- Investitionen für Wachstum
- Investitionen für Wachstum in Griechenland
-
Auswirkungen staatlicher Eingriffe
Dieser letzte Teil der ursprünglichen Forschungsarbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der EU-Interventionen in den Mitgliedstaaten nach 2007-2008, einschließlich deren Quantifizierung anhand öffentlich verfügbarer Daten. Die Auswirkungen der Interventionen auf die Arbeitslosigkeit und das Wirtschaftswachstum werden zusammengefasst und es wird festgestellt, dass sie sich in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgewirkt haben, wobei die südeuropäischen Länder stärker betroffen waren als die nördlichen Länder. Der Einfluss der Sparmaßnahmen wird anhand von Belegen aus verschiedenen Quellen bewertet, und es wird festgestellt, dass die Intervention der EU mit einer einzigen Politik für die wirtschaftliche Erholung aller Mitgliedstaaten fehlerhaft ist. Die Abneigung der EU, Ratschläge von außerhalb ihrer eigenen Berater zu berücksichtigen, eine Unfähigkeit zu lernen, wird als Grund für ihr Versagen bei der Umsetzung geeigneter Interventionen zur Unterstützung der Wiederbelebung der Volkswirtschaften aller Mitgliedstaaten der Eurozone und nicht nur derjenigen mit niedrigen Anfangsdefiziten genannt. Der letzte Abschnitt zeigt, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in diesem Zeitraum nicht angemessen angewandt wurde, was beispielsweise durch die erheblichen Unterschiede bei den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der EU-Interventionen in den Mitgliedstaaten und den dominierenden Einfluss Deutschlands auf die EU-Politik und die Änderungen der Rechtsvorschriften belegt wird. Die wichtigsten Spillover-Effekte auf die Mitglieder der Eurozone und die Nicht-Eurozone werden ebenfalls zusammengefasst.
Überblick über die Auswirkungen staatlicher Interventionen auf den Arbeitsmarkt und das Wachstum
- Trends bei Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum
- Portugal als Beispiel für den Erfolg der Austeritätsstrategie
- Die Beveridge-Kurve als Beschäftigungsindikator
- Auswirkungen der Unsicherheit auf die Arbeitslosigkeit
Intervention Austeritätsmaßnahmen, Probleme und Auswirkungen
- Konjunkturzyklen, Politiken und Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum
- Staatliche Eingriffe und die daraus resultierenden Probleme
- Portugal
- Spanien
- Italien
- Deutschland
- Griechenland
- Frankreich
Grundsatz der Proportionalität
Übertragungseffekte von EU-Politiken
-
Fallstudien: Die EU im Jahr 2020
Dieses Kapitel vergleicht die wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung in drei der ursprünglichen EWG-Mitgliedstaaten von ihrer ursprünglichen Mitgliedschaft bis Mitte 2020. Drei Fallstudien, die in Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich durchgeführt wurden, untersuchen die Geschichte vor 2008, die EU-Interventionen in der Zeit nach der Finanzkrise und deren Auswirkungen auf die nationalen sozialen und wirtschaftlichen Trends. Da diese drei Mitgliedstaaten zu den Gründungsmitgliedern der EWG gehören, aber unterschiedliche Erfahrungen und Ergebnisse mit denselben EU-Politiken gemacht haben, werden die möglichen Gründe für diese Unterschiede untersucht. Die Ergebnisse von Erhebungen, die in jedem dieser Länder durchgeführt wurden, werden im Hinblick darauf vorgestellt, inwieweit die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität in jedem Fall angewandt wurden. In einem kurzen Epilog wird die aktuelle Situation skizziert, die den anhaltenden Einfluss Deutschlands auf die EU-Politik unterstreicht und den Mangel an Solidarität zwischen den EU-Ländern während der Coronavirus-Pandemie und der Reaktion der EU darauf verdeutlicht.
Fallstudie 1: Vereinigtes Königreich
- Hintergrund
- Die UK-EU Beziehung seit 2008
- Primärforschung zur UK-Fallstudie
- UK Umfrageanalyse und Diskussion
- Hypothesenprüfung
Fallstudie 2: Deutschland
- Hintergrund
- Deutsche Wirtschaftstrends und Beziehungen zur EU ab 2008
- Deutschland und die EU
- Primärforschung zur deutschen Fallstudie
- Deutschland Umfrageanalyse und Diskussion
- Hypothesenprüfung
Fallstudie 3: Italien
- Einleitung
- Hintergrund
- Das Wirtschaftswunder
- Italiens wirtschaftliche Entwicklung seit der Finanzkrise 2008
- Wichtige politische Interventionen der EU in Italien seit 2009
- Eine dritte italienische Rezession: Auswirkungen auf Europa
- Primärforschung zur Fallstudie Italien
- Italien Umfrageanalyse und Diskussion
- Hypothesenprüfung
Beschränkungen und Ergebnisse der Fallstudie
Erhältlich in gedruckter und digitaler Form
AUTOR
Sebastian Weißschnur
Sebastian Weißschnur ist Gesellschafter und Geschäftsführer mehrerer Unternehmen in Deutschland, den USA und den Emiraten, und wird seit 2007 fortlaufend als einer der Top 15 Finanzberater (von mehr als 100.000) in Deutschland geführt. Er absolvierte einen Bachelor- und einen Masterstudiengang in Betriebswirtschaft sowie Weiterbildungen in Finanz- und Wirtschaftswissenschaften an renommierten Institutionen, unter anderem an der Harvard Business School. Seine Forschungsarbeiten, Lehrbücher und Artikel wurden in führenden Fachzeitschriften, z.B. über den renommierten Verlag Springer Professional, veröffentlicht. Seine Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Politikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Steuerpolitik und Makroökonomie, insbesondere Interventionsmaßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen in den EU-Mitgliedstaaten.
„Dies ist ein ausgezeichnetes Buch, das einen umfassenden Einblick in die staatlichen Interventionen und die EU-Politik als Reaktion auf die Wirtschaftskrise gibt, die die europäischen Volkswirtschaften seit 2008 beeinträchtigt hat. Sehr empfehlenswert für jeden, der sich für die sozioökonomischen Probleme Europas, die Einschränkungen durch seine fehlerhafte institutionelle Architektur und die künftigen Herausforderungen interessiert.“
Muhammad Ali Nasir, außerordentlicher Professor für Wirtschaftswissenschaften
an der Universität von Leeds und Gastwissenschaftler an der Universität von Cambridge sowie Autor von "Off the Target: The Stagnating Political Economy of Europe and Post-Pandemic Recovery".
Taste„[…] Aufgrund der tiefgehenden und umfassenden Recherche und Analyse der Daten von 2008 bis 2020 kann diese Publikation als ein wissenschaftliches Werk bezeichnet werden, das sich jeder Experte im Financebereich ansehen sollte, um die Zusammenhänge der Finanzkrise und die Folgen daraus, aber auch Lösungsvorschläge kennenzulernen. […] Abgerundet wird das Buch durch eine Vielzahl von Case Studies, durch die man noch einen tieferen Einblick in die Materie gewinnen kann.“
Michael Hauer, Professor für Finanzmärkte und Financial Planning
an der ebs European Business School, Oestrich-Winkel sowie an der Hochschule Amberg-Weiden.
Taste„Ich hatte eine hervorragende Erfahrung mit Sebastian Weißschnur bei der Veröffentlichung seines Buches 'The Proportionality of State Intervention'. Ich fand ihn sehr professionell und seine Fähigkeit, sein Fachwissen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften zu vermitteln, machen ihn zu einem überaus geeigneten Autor.“
Wyndham Hacket Pain, Senior Editor, Palgrave Macmillan
The Proportionality of State Intervention
„Wissenschaftlich fundiert betrachtet Herr Weißschnur die weltweite Nahrungsmittelspekulation. Seine Sicht auf das kontrovers diskutierte Thema ist vielseitig. Damit hebt sich der Autor deutlich von anderen ab. Spannend sind seine Handlungsempfehlungen zur Bewertung prominenter Non-Profit-Organisationen und zur Verwendung von Spendengeldern, die auf neuen Erkenntnissen einer eigenen Online-Befragung basieren. Exzellent!“
Dr. Günter Horzetzky, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk
Fundraising gegen Hungerkrisen
Taste
ALLE BÜCHER VON SEBASTIAN WEISSSCHNUR:
Die Verhältnismäßigkeit staatlicher Intervention: Reaktionen der EU auf die globale Wirtschaftskrise, 2008–2020
(Englische Ausgabe)
Finanzprodukte in Zeiten der Vertrauenskrise: Innovative und nachfrageadäquate Produktansätze
(Deutsche Ausgabe)
Entwicklung einer Marketingkonzeption am Beispiel eines gastronomischen Investorenprojektes in einem Kurort
(Deutsche Ausgabe)
Gesundheitsförderlicher Umgang mit Beschäftigten eines privatwirtschaftlichen Unternehmens in Zeiten des Change Managements am Beispiel der Salutogenese
(Deutsche Ausgabe)
Fundraising gegen Hungerkrisen: Aufgaben und Wirksamkeit von Non-Profit-Organisationen
(Deutsche Ausgabe)
Berufsunfähigkeits-versicherung für Dummies
(Deutsche Ausgabe)